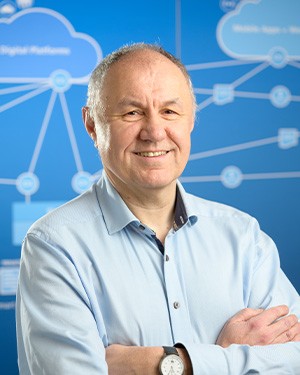Wie können europäische Lieferketten widerstandsfähiger, nachhaltiger und zukunftssicher werden? Das EU-Projekt ReSChape liefert Antworten – mit fundierten Analysen, konkreten Handlungsempfehlungen und praxisnahen Impulsen für Wirtschaft und Politik.
Globale Lieferketten stehen unter Druck. Zwischen geopolitischen Spannungen, regulatorischen Hürden und digitalem Wandel geraten eingespielte Prozesse zunehmend ins Wanken. Doch wie lässt sich unter diesen Voraussetzungen ein stabiles, widerstandsfähiges Netzwerk von Waren- und Informationsflüssen aufbauen? Antworten liefert das europäische Forschungsprojekt ReSChape. Gemeinsam mit internationalen Partnern entwickelt das Fraunhofer IML Empfehlungen und Strategien, um Europas Lieferketten widerstandsfähiger, nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten. Dr. Markus Witthaut, Senior Scientist am Institut, gibt Einblick in die Erkenntnisse und Perspektiven des Projekts – und zeigt, warum strategisches Denken heute wichtiger ist denn je.
 Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML