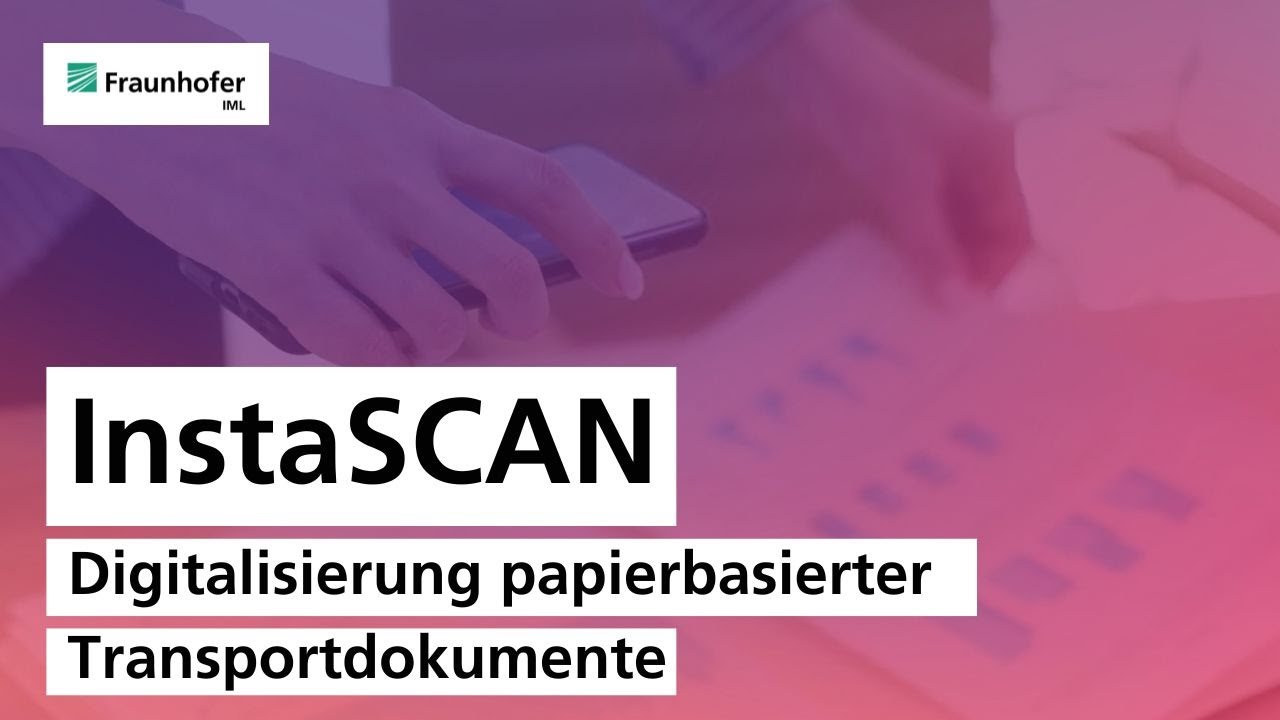Automatisierung, Transparenz, Vertrauen: Das Projekt SKALA verdeutlicht, dass Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie zu echten Gamechangern für die Logistik werden. Dabei verbinden skalierbare Open-Source-Lösungen ganze Wertschöpfungsnetzwerke miteinander, wovon vor allem kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren können.
Am Fraunhofer IML arbeiten derzeit zahlreiche Forschende daran, die Logistik von morgen grundlegend neu zu gestalten. Ein zentrales Vorhaben dabei ist SKALA: Ein vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) gefördertes Forschungsprojekt, das Künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie zu einem intelligenten Ökosystem verbindet. Ziel ist es, Produktions- und Logistikprozesse über Unternehmensgrenzen hinweg effizienter, transparenter und robuster zu machen.
»Wir sehen in der Kombination von KI und Blockchain nicht nur ein technologisches Potenzial, sondern eine strukturelle Antwort auf viele der Herausforderungen, vor denen die Logistik heute steht«, sagt Dr. Maximilian Austerjost, Projektleiter am Fraunhofer IML. SKALA stehe dabei nicht für eine Insellösung, sondern für einen modularen, offenen Baukasten, der sich an die Bedarfe unterschiedlichster Unternehmen anpassen lässt.
 Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML