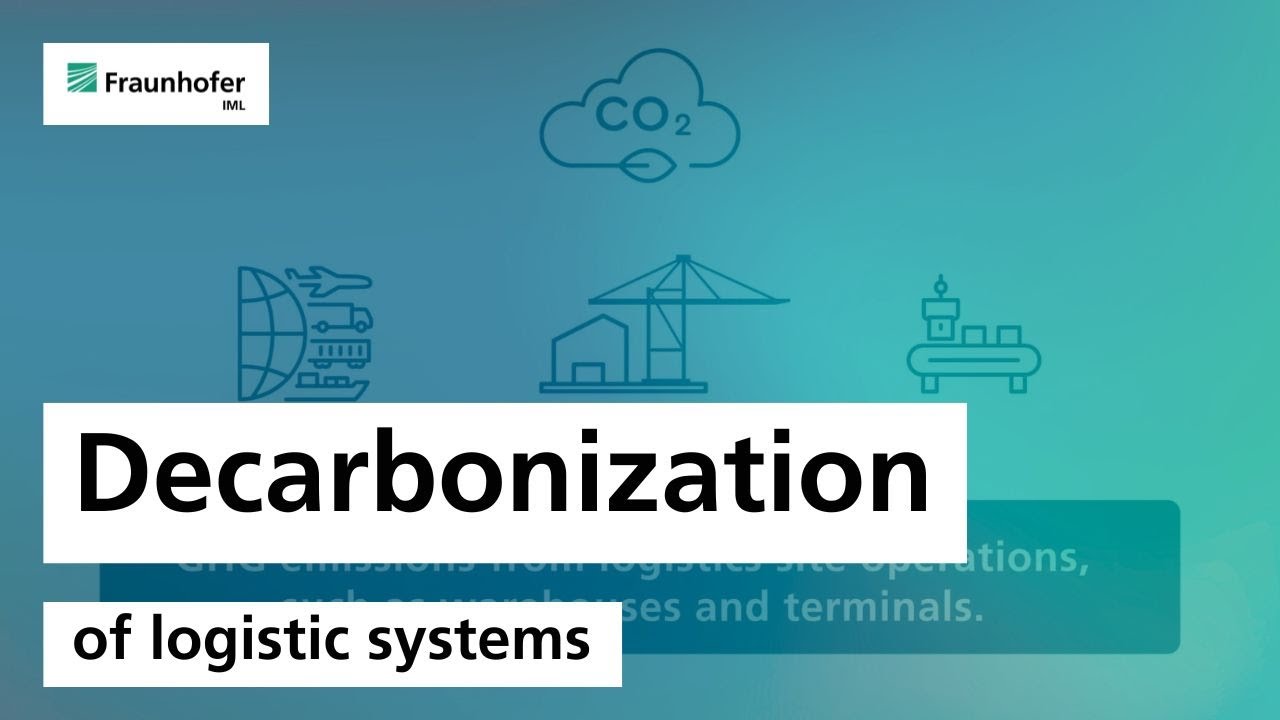Frühmorgens verlässt ein Containerschiff den Hafen Rotterdam. Es steuert Richtung Hamburg. Dort angekommen, werden Container verladen. Die Waren aus den Containern werden auf Züge oder Lkw verteilt und an ihre Zwischenziele gebracht. Hier werden die Waren in großen Hallen sortiert, gescannt, weitergeleitet, gehoben, verschoben und umgepackt. Verstaut warten sie auf ihren weiteren Weg, bevor sie irgendwann auf ähnliche Weise ihren Zielort erreichen. Dabei begleitet werden sie von ihren unsichtbaren Treibhausgas-Emissionen, die von Etappe zu Etappe mehr werden.
Der Anteil der Logistik und des Transportes von Gütern und Waren an den weltweiten CO2-Emissionen beträgt nach Studien des World Economic Forum (WEF) etwa 5,5 Prozent. Da die internationale Vernetzung und die Globalisierung zunehmen, ist auch die Tendenz der Emissionen steigend. Wie hoch der Ausstoß von Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) im Einzelnen ist, kann gar nicht so leicht ermittelt werden, da jede Branche verschiedene Einflussfaktoren hat, die auf die Emissionen einwirken. Für eine Vergleichbarkeit dieser Emissionen müssen diese auch noch mit gleichen Maßstäben berechnet werden können. Genau daran wird seit Jahrzenten gearbeitet.
Als Branche ist die Logistik sehr vielfältig: Es gibt nicht nur verschiedene Transportwege, auch die Umschlag- und Lagerstandorte sind sehr unterschiedlich. Schließlich sind die Güter und Waren, die gelagert und transportiert werden, extrem vielfältig: Kleidung, Pflaster, Bananen, Schrauben, Flüssiggas, Tiefkühlkost, Chemikalien und Regale sind nur wenige Beispiele. Alles, was von A nach B transportiert wird, muss entsprechend den jeweiligen Eigenschaften gelagert und befördert werden. Hier eine Vergleichbarkeit nur für die Logistikstandorte herzustellen, ist schon allein wegen der Vielfältigkeit eine Herausforderung. »Es dürfen keine Äpfel mit Birnen verglichen werden, deshalb braucht es den international gültigen Standard«, so Dr. Kerstin Dobers, stellvertretende Abteilungsleitung der Abteilung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft am Fraunhofer IML. Sie ist die Expertin für die Berechnung von Emissionen an Logistikstandorten und hat den seit 2023 veröffentlichten, weltweit gültigen Standard »ISO 14083« für die Ermittlung von THG-Emissionen im Transportsektor mitentwickelt. Der Standard ist das Ergebnis jahrzehntelanger Arbeit, einiger Umwege und großer Ambitionen: Klimaneutralität.
 Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML